Über die Grenzen hinweg und hinaus
Gespräch mit Karl-Markus Gauß
Karl-Markus Gauß, vielfältiger und streitbarer Essayist, Kritiker, Herausgeber und Erzähler, erinnert sich im Gespräch mit Elena Messner im Oktober 2012 an sein literarisches, journalistisches und herausgeberisches Engagement. Zuletzt sind Ruhm am Nachmittag (2012) und Im Wald der Metropolen (2010) bei Zsolnay erscheinen, sowie der von Herbert Ohrlinger und Daniela Strigl unter dem Titel Grenzgänge: der Schriftsteller Karl-Markus Gauß herausgegebene Sammelband, der essayistische, literaturwissenschaftliche und literarisch-persönliche Annäherungen an den Autor versammelt.

Karl-Markus Gauß, Sie sind vielfältiger Autor, Reiseschriftsteller, Essayist, Romanschriftsteller, zudem aber auch Literaturkritiker und nicht zuletzt Herausgeber der Zeitschrift "Literatur und Kritik". Ihre Arbeits- und Themenbereiche greifen ständig und wiederholt ineinander. Bleiben wir zunächst bei der literaturvermittelnden Funktion, die Sie jahrzenhntelang einnehmen, also bei Ihrer Funktion als Kritiker und Herausgeber. Ihre Einsetzung als Chefredakteur von „Literatur und Kritik“ lässt sich, so heißt es, auch als explizite Reaktion auf den Fall des Eisernen Vorhangs verstehen und sollte damals die ursprüngliche Linie der Zeitschrift, sich den slawischen Literaturen und Literaturen Süd-Osteuropas zu wimden, wieder aufleben lassen. Das äußerte sich etwa darin, dass Sie die Literatur der mittel- und osteuropäischen Länder wieder zum Programm machten, Texte dieser AutorInnen publizierten, aber auch länderspezifische Dossiers konzipierten, aber auch generell auf unbekannte AutorInnen fokussierten. Würden Sie sich mit uns noch einmal an diese Zeit erinnern, und uns mitteilen, wie Sie diese Aufgabe wahrnahmen, was Sie daran besonders reizte, und worin Ihre Motivation lag?
Zunächst möchte ich eine Korrektur anbringen. Ich bin zwar, hoffe ich, tatsächlich nicht nur deswegen ein vielseitiger Autor, weil ich viele Seiten geschrieben, sondern auch weil ich selbst verschiedene Seiten habe. Gleichwohl habe ich keines meiner Bücher bisher als Roman bezeichnet. Allerdings haben einige Literaturwissenschaftler, namentlich Klaus Zeyringer und Hans Höller sowie deren Studenten und Studentinnen, in meinen Journalen sowie im "Wald der Metropolen" romanhafte Züge entdeckt, ja sogar behauptet, ich würde in diesen Büchern einen eigenen Typus von Roman erschaffen. Diese Aussagen nahm ich gerne zur Kenntnis, aber ich selbst habe unter keinen meiner Texte die Gattungsbezeichnung "Roman" geschrieben.
Als ich vom Verleger des Otto Müller-Verlags 1990 gefragt wurde, ob ich die Herausgeberschaft von "Literatur und Kritik" übernehmen wollte, war das eine krisenhafte Zeit: Es zerfiel der Ostblock, es begann Jugoslawien zu zerfallen, und da gab es eine Zeitschrift, die zwar einiges Ansehen genoss, aber nicht mehr wirklich wahrgenommen wurde und mehr historische Verdienste als interessante Gegenwart hatte. Da war es für mich verlockend, erstens diese Aufgabe zu übernehmen und zweitens an eine alte, fast schon abgebrochene Tradition der Zeitschrift aus der Ära des ersten Chefredakteurs Gerhard Fritsch anzuschließen, nämlich den Blick über Österreich im engeren Sinne hinaus in alle Länder zu richten, die einstmals zur Donaumonarchie gehört hatten und darüber hinaus auch auf die anderen Regionen des Balkans und des sogenannten Ostens. Diese waren damals tatsächlich so etwas wie unbekannte Landschaften der europäischen Literatur. Zu den wichtigsten Dingen, die mir als Herausgeber gelangen (und es gibt anderes, das mir gar nicht gelang), zählt es, dass "Literatur und Kritik" während der blutigen Zerfallskriege Jugoslawiens den Autoren aller postjugoslawischen Länder ein Forum für ihre Texte geboten hat und damit auch die Möglichkeit, miteinander noch überhaupt ein Gepräch aufrecht zu erhalten. Schon das dritte Heft im ersten von mir zu verantwortenden Jahrgang 1991 hatte als Schwerpunkt "Das Ende von etwas. Nachsätze zu Jugoslawien", und in dieser Ausgabe sind serbische Autoren wie David Albahari, kroatische wie Nedjelko Fabrio, slowenische wie Ales Debeljak, kosovarische wie Din Mehmeti vereint, also Autoren, deren Länder sich damals in kriegerischen Auseinandersetzungen miteinander befanden. Das haben wir all die Jahre der Balkankriege so durchgehalten, der bosnische Autor Dzevad Karahasan war zeitweise sogar im Beirat der Zeitschrift. Ich hatte von Anfang an Berater, gerade was die östliche Orientierung der Zeitschrift ausmacht, besonders Ludwig Hartinger war hier als Literaturkundschafter unermüdlich tätig für uns. Natürlich war es für mich interessant, den einzelnen Literaturen des Balkans und Osteuropas eigene Dossiers zu widmen, weil damals ein wirklicher Nachholbedarf bestand, das heißt fast niemand etwas von der bulgarischen oder slowakischen, der kosovarischen oder ukrainischen Literatur wusste. Hier haben wir, glaube ich, schon literarische Fährtensuche betrieben und Hefte vorgelegt, die Neues und Unbekanntes entdeckten und dank denen sich auch das, was sich gerade politisch ereignete, besser verstehen ließ, denn die wahre Geschichte der Nationen wird ja in deren Literatur geschrieben. Ungefähr um die Jahrtausendwende konnten wir es hier ein wenig ruhiger angehen, denn mittlerweile waren etliche Verlage im deutschen Sprachraum auf den Osten gekommen.

Würden Sie sagen, dass z.B. das literaturvermitelnde Engagement Ihrereseits Früchte getragen hat? Hat sich etwa die Wahrnehmung südosteuropäisher Literatur in der deutschsprachigen Öffentlichkeit verändert?
Ich weiß, daß nicht wenige Schriftsteller, serbische und ukrainische, auch bulgarische und die anderer Sprachen, über uns, über die Erstveröffentlichung ihrer Texte in "Literatur und Kritik" von den Scouts und Lektoren der Verlage entdeckt worden sind, und das ist eine Sache, die mich sehr freut (auch wenn, ich sage es ohne Bitterkeit, aber nicht völlig ohne verletzte Eitelkeit, einige dieser Autoren und dieser Verlage das mittlerweile vergessen haben). Was meine Arbeit anbelangt, so habe ich vor allem in den späten achtziger und in den neunziger Jahren ja ausgesprochen leidenschaftlich und intensiv auch als Literaturkritiker gearbeitet und im Jahr durchschnittlich siebzig Artikel in großen und kleinen, bekannten und renitent abweichenden Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht. Kein geringer Teil dieser Artikel waren Literaturkritiken und Rezensionen, und davon wiederum waren viele der Literatur eben jener Länder gewidmet, der ich auch als Herausgeber von "Literatur und Kritik" besonderes Augenmerk zukommen ließ. Ich staune heute, wenn ich mich gelegentlich ein wenig in meinem privaten Archiv umsehe, über wieviele Autoren des Ostens ich damals schrieb, was allerdings zur Voraussetzung hatte, daß ich auch die Medien vorfand, die an dieser Literatur und meiner Literaturkritik interessiert waren. Ich habe in der "Zeit" und in der Neuen Zürcher Zeitung zum Beispiel oft eine ganze Seite zur Verfügung gestellt bekommen, um über Miroslav Krleza oder David Albahari, über Wyslawa Szymborska oder Adam Zagajewski (um Polen nicht zu vergessen) zu schreiben. Das Ganze hatte auch einen nicht uninteressanten materiellen Aspekt bzw. seine finanzielle Seite. Ich konnte Anfang der neunziger Jahre tatsächlich als fleißiger Literaturkritiker eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern von meinen Rezensionen und Kritiken ernähren; so viel könnte ich heute gar nicht publizieren, daß ich immer noch mit dieser Tätigkeit meine materielle Existenz bestreiten könnte. Es hat seither einen dramatischen Verfall der Honorare in der Presse gegeben, der im Augenblick gerade dazu führt, daß der Berufsstand des freien Publizisten ausstirbt. Ich kann keinem jungen Kollegen, keiner jüngeren Kollegin, wie produktiv, kenntnisreich und begabt die auch immer sein mögen, den Rat geben, sie mögen es als freischaffende Publizisten probieren. Das geht nicht mehr. Und dass das nicht mehr geht, wird übrigens auch Folgen für das haben, was man kritische Öffentlichkeit nennt. Ich selbst habe mich als Kritiker schon von meinen ersten Zeitungspublikationen her immer sehr für die mitteleuropäische und osteuropäische Literatur interessiert, auch einige meiner allerersten Bücher, vor allem "Tinte ist bitter" und "Die Vernichtung Mitteleuropas", sind ja stark von dem Versuch, mir eine andere Art von europäischem Kanon zu erarbeiten, bestimmt. Das waren, nachträglich gesehen, sehr glückliche Jahre, weil ich vieles, was ich damals für mich entdeckte, auch anderen zur Entdeckung empfehlen konnte; diese publizistische Arbeit ist damals nicht unbemerkt und folgenlos geblieben. Die Veränderung der Medien in den letzten Jahren lässt mich diese Zeit fast als goldene Ära der kritischen Publizistik erscheinen. Ich war damals ein junger, unbekannter Mann und es war mir möglich, fast überall über fast alle Themen, die mir wichtig waren, zu veröffentlichen.

Ihre Journale, Bücher, Essays und Romane erscheinen derzeit im Verlag Paul Zsolnay. Ihre Texte wären möglicherweise als „hybride“ zu bezeichnen: Gattungsgrenzen verschwimmen, Reisetexte und Tagebücher überschneiden sich mit literarischen, literaturkritischen und politischen Essays, Fiktion mit „Faktion“. Auch zwei Ihrer aktuellsten Bücher, „Im Wald der Metropolen“ und „Ruhm am Nachmittag“ führen dies vor. Diese „Hybridität“ scheint Programm? Wieviel Absicht, wieviel Notwendigkeit, die sich aus Thematik, Interesse an politischen Themen und anderen Faktoren begründet, steht dahinter? WIe sehen Sie dies auch in einem Ihrer jüngsten Bücher, "Wald der Metropolen" (2009), verwirklicht?
Tatsächlich habe ich mich in meinen Büchern in den letzten Jahren immer weiter von der klassischen Form des Essays entfernt. Das ging einerseits fast unbemerkt und wie selbstverständlich vor sich, bei der Arbeit an jedem neuen Buch ist es geradezu absichtslos einfach immer ein Stückchen weiter gegangen mit mir; andrerseits ist mir diese Entwicklung, die ich mir nicht ausdrücklich vorgenommen hatte, nach einiger Zeit selbst nicht unbemerkt geblieben, sodass ich sie natürlich reflektierte. Warum schreibe ich zwischen den Genres und Formen? Ich glaube, aus zwei Gründen: Erstens, weil mir die eine Form alleine zu eng ist für alles, was ich sagen möchte und was zu sagen ich mir nicht untersagen will. Und zweitens: Weil diese Vermischung der Formen zu einem neuen Ganzen meiner Persönlichkeit entspricht, die sich nämlich auf viele verschiedene Dinge bezieht, aber dann doch noch so etwas wie das Vereinende, Zusammengehörige, Verbindende dieser verschiedenen Dinge anstrebt. Um es geschwollen auszudrücken: Ich bin ein Zerrissener mit der Sehnsucht nach Ganzheit. Oder anders gesagt: Ich interessiere mich für die Welt in vielen ihrer Facetten und kann gar nicht anders, als vielfältig auf diese Vielfalt zu reagieren - aber ich verspüre den starken Drang, dann selbst doch noch wenigstens für mich schreibend so etwas wie einen Zusammenhang im Disparaten herzustellen. Vielleicht schreibe ich ja überhaupt deswegen: Um mir selbst immerhin die Ahnung dessen zu sichern, dass die Dinge zusammengehören, dass auch mein Leben mehr ist als eine beliebige und zufällig Abfolge von Ereignissen, und dass sich zwischen mir und der Epoche, in der ich lebe, in Widerspruch und Einverständnis ein Zusammenhang herstellen lässt. Es geht dabei also auch darum, schreibend eine Perspektive zu finden, die mich in lauter Scherben doch das Gefäß als solches erkennen lässt. Ich bin also einerseits fasziniert von den Scherben und sammle und suche sie überall, und andrerseits noch der konservativen Auffassung, dass sich in ihnen die Idee des Gefäßes erhaschen lassen kann.
In den Journalen bin ich, was die Vielfalt an Formen betrifft, vermutlich am weitesten gegangen: da finden sich klassische Essays, politische Kommentare, Glossen, Nachrufe, Kritiken, Aphorismen, kurze Erzählungen, Satiren, philosophische Betrachtungen... also verschiedene Genres aneinander gefügt und ineinander gespiegelt. Das ist nicht einfach nur ein Hintereinander von disparaten Erzählsegmenten, sonder ein kompositorisch stark aufeinander bezogenes Ganzes.
Im "Wald der Metropolen" bin ich es wiederum auf andere Weise radikaler noch, glaube ich, angegangen. Die zwei Ebenen sind: Persönliches Erlebnis und kulturhistorischer Zusammenhang. Beides ist gleich wichtig in diesem Buch: Dass ich immer von ganz persönlichen Erlebnissen ausgehe - wenn ich einem grimassierenden Menschen begegne, in einer kleinen Stadt ein Todesahnung erleide, auf einer griechischen Insel mit der Langeweile zu kämpfen habe; und von diesen persönlichen Erlebnissen ausgehend, spannt sich dann ein Bogen durch einige Jahrhunderte europäischer Kulturgeschichte, mit Zusammenhängen, die teilweise wohl auch Spezialisten nicht unbedingt bekannt waren und die gewissermaßen ein Netz über ganz Europa werfen. Was ist dabei das treibende Movens bei mir? Wieder der Versuch, zwischen dem Entlegenen und dem Nahen, dem Persönlichen und dem Historischen, dem Subjektiven und dem Objektiven schreibend Zusammenhänge herzustellen. Mich reizt es eben nicht, einen rein subjektiven Text über meine Gefühle beim Reisen zu verfassen, aber es reizt mich auch nicht, als wissenschaftlicher Kulturhistoriker zu dilettieren. Ich brauche für mein Ich auch die Welt - und in der Welt finde ich auch mich. Es ist also doch wieder auch der Austausch wichtig, den ich oben schon als Merkmal meiner Journale beschrieben habe. Für all dies taugt, meiner Meinung nach, die überkommene Romanform nicht, oder zumindest taugt sie mir nicht. Meine Bücher hatten schon immer keine Gattungsbezeichnungen im Untertitel oder wenn, dann von mir behelfsmäßig erfundene. Mein Buch "Ins unentdeckte Österreich" habe ich "Nachrufe und Attacken" genannt, und "Der Mann, der ins Gefrierfach wollte" heißt im Untertitel "Albumblätter". Bei "Im Wald der Metropolen" war es der Wunsch des Verlags, dass ich als Untertitel "Roman" setze, ich habe es aber dann doch nicht getan, vielleicht auch aus Feigheit.
Sehe ich mich ein wenig in der Literatur der Gegenwart um, kommen mir oft die Bücher von solchen Autoren am spannendsten vor, die ähnlich wie ich, aber eben auf ihre andere Weise auch gewissermaßen zwischen den Gattungen schreiben oder eigene erfinden. Eduardo Galeano, der uruguayische Autor, schreibt z.B. lateinamerikanische Weltgeschichte aus lauter kleinen Anekdoten, Erzählungen, Mythen; von Handke gefallen mir die von ihm so genannten "Versuche" am besten; der polnische Autor Andrzej Stasiuk (es gibt eine polnische Disseration, die meine Bücher und seine vergleicht) verbindet Roman und Reportage auf ganz eigene Art; und an Sebald finde ich auch diese Vermischung der Genres interessant (ich bin aber sonst kein Fan von ihm, finde ihn sprachlich gespreizt und erkünstelt. Ja, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster: Ich wundere mich, warum seine, nicht meine Bücher in aller Welt gelesen werden. Gut, ich will mich nicht beschweren.)
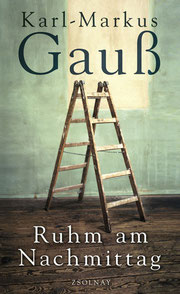
Man bezeichnete Sie z.B. als „Zeitdiagnostiker“, „Autors fürs Marginale“ oder als „engagierter Essayist“. Könnte man sagen, dass Ihr Engagement in der Literaturvermittlung auch immer einher geht mit Ihrem eignene „politischen“ Engagement bzw. umgekehrt? Wie aber gestaltet sich hier andererseits die komplizierte Frage von kritischer Haltung und dem Faktum, dass Sie auch ein etablierter Autor sind, mit gewissen Möglichkeiten im kulturellen Feld, der auch regelmäßig in Kontroversen, gar Angriffen seitens verscheidener (politischer) Seiten verwickelt wird? Wie würden Sie sich selbst im politischen und im kulturellen Feld positionieren? Oder auch: kann man Ihrer Ansicht nach überhaupt literarisch und intellektuell tätig sein, ohne eine gewisse „engagierte“ Komponente?
Ich möchte niemanden dazu verpflichten, "engagiert" zu sein. Das hauptsächliche Engagement des Autors ist ohnehin das Schreiben selbst, und in seinem Schreiben muss sich auch das finden, was mein seine gesellschaftskritische Tätigkeit nennt. Andrerseits gibt es Anlässe und Gründe, mit diesem Schreiben an die Öffentlichkeit zu gehen, seine Öffentlichkeit zu suchen, gegebenenfalls sogar zu mobilisieren, und es gibt auch schriftstellerisches Engagement, das über das Schreiben hinausgeht und sich also nicht nur im Geschriebenen findet.
Ich selbst erlange meine Wirkung auf oder Bedeutung für die Gesellschaft fast immer unmittelbar durch mein Schreiben. Alle Kontroversen, die es mit mir gegeben hat, alle Auseinandersetzungen, in die ich hineingezogen wurde, sind auf bestimmte Passagen in meinen Büchern oder häufiger in meinen Artikeln zurückgegangen. In der sog. Jelinek-Gauß-Kontroverse um meinen Silvesterartikel im Standard des Jahres 2001, in dem ich beklagte, es gebe mittlerweile einen wohlfeilen rhetorischen Antifaschismus, der sich nicht im geringsten darum schert, die Widerstandskämpfer gegen den realen Faschismus zu würdigen, ihre Werke fruchtbar zu machen, ist mir von Jelinek seinerzeit vorgeworfen worden, ich würde reaktionäre Österreich-Verklärung betreiben. Die KPÖ hat damals festgehalten, daß meine Positionen ihr in diesem Falle näher seien als die ihres Partei-Mitglieds Jelinek. Ich habe diese Kontroverse, die mir sehr viel Häme und Spott eingetragen hat, unlängst wieder mal anhand der Texte, um die es geht, angeschaut und muss sagen: ich hatte absolut recht. Aber das ist nicht so wichtig, es ist nur ein Zeichen dafür, wie wenig Hoffnungen man darauf setzen soll, dass man mittels Polemiken und öffentlichem Streit wirklich aufklärerische Wirkung erreicht. Man muss es natürlich trotzdem versuchen, aber sich vom Scheitern unabhängig machen, es darf einen weder verbittern noch klein machen, man muss mit ihm rechnen und trotzdem sagen, was man glaubt, sagen zu müssen. Ich überschätze meine Rolle in der österreichischen Öffentlichkeit nicht.
Manchmal, eher selten, aber doch, gibt es für mich Anlass, aus meinem Arbeitszimmer ausziehen und mich für bestimmte gesellschaftliche Anliegen in die Öffentlichkeit zu begeben. Das war in diesem Jahr in Salzburg z.B. der Fall, als die Hetze, die von den Salzburger Lokalpolitikern sowie der lokalen Presse gegen die Roma-Bettler betrieben wurde, ein solches Ausmaß erreichte, dass eine Unterkunft der Roma überfallen, sie selbst zu den größten Kriminellen unserer Zeit ernannt und der allgemeinen Ächtung der Bevölkerung preisgegeben wurden. Damals habe ich einiges unternommen, was über das eigentliche Engagement eines Schreibers mittels Schreibens hinausgegangen ist. Ich bin an die Uni gegangen und habe dort mit dem Grazer Armenpfarrer Pucher diskutiert, ich habe eine Pressekonferenz abgehalten, die in den Landesnachrichten im Fernsehen aufgegriffen wurde, ich habe mein striktes Gebot, mich mit den Salzburger Nachrichten nicht einzulassen, befristet aufgehoben und einem Redakteur ein Interview gegeben, ich habe bei einer Veranstaltung mit Salzburger Politikern diesen versucht, Aufklärung über die Roma, die in Salzburg betteln, zu geben. Dieses Engagement geht über das rein schriftstellerische hinaus, bezieht seine gesellschaftliche Wirkung aber aus der Tatsache, dass ich vorher als Schriftsteller über Jahre engagiert tätig war. Denn man hört mir ja zu, eben weil ich ein gewisses schriftstellerisches Renomee in die Waagschale werfen kann; und weil ich ein Buch über die Roma geschrieben und in Salzburg diverse Preise bekommen habe, und weil mein Name als Autor da und dort in den Medien genannt wurde... Der Erfolg dieses gewissermaßen auf der Literatur fußendem, aber über das Literarische hinausgehenden Engagement ist freilich gering genug: Die Pressekonferenz wurde im ORF völlig falsch dargestellt und meine Aussagen wurden vom romaphoben Vizebürgermeisterf, der weder bei der Pressekonferenz zugegen war, noch irgendeine Ahnung hat, in der gleichen Sendung gekontert. Das Interview, das ich den Salzburger Nachrichten gegeben habe, ist einer für mich geradezu peinlichen Weichspülung meiner kontroversiell ausgerichteten Aussagen unterzogen worden, sodass sich jeder Freizeithumanist damit einverstanden erklären konnte. Und die Politiker, von denen es in Salzburg etliche gibt, die mir privat ihre Wertschätzung erklären, haben mir brav zugehört, freundlich zugenickt, nachher herzlich die Hand geschüttelt - und ein paar Tage später genau das Gesetz beschlossen, das ich verhindern wollte. Das heißt, sie nehmen mich zwar als Gestalt des öffentlichen Lebens wahr und erweisen mir als relativ bekanntem Autor dieser Stadt die Reverenz, aber sie nehmen, was ich politisch sage, nicht ernst, nicht einmal zur Kenntnis. Damit möchte ich aber nicht gleich zerknirscht behaupten, daß also eh alles wurscht und verloren ist und es sinnlos war, mich überhaupt zu engagieren. Obwohl die Wirkung vielleicht nur die ist, dass ohne mich alles noch ein klein wenig ärger ausgegangen wäre. Das ist natürlich eine miserable Ausbeute, ein fauler Kompromiss, also gerade das, was man als Künstler nicht tun darf, denn in einer Gesellschaft, in der ohnehin nur die Herrschenden keine Kompromisse machen, aber die Unterdrückten dauernd zu solchen genötigt werden, sollten Künstler nicht für Kompromisse zu haben sein. Ich bin ja auch nicht dafür zu haben und habe mich auch nicht in den Kompromiss gefügt; ich muss aber erkennen, dass die Wirkung, die mein diesbezügliches Engagement erzielte, bestürzend gering war.
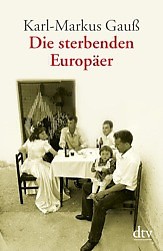
Mich würden für unser Gespräch noch zwei weitere Fragenkomplexe interessieren, die zurück zu "Südosteuropa" führen: Die erste schlägt den Bogen zur Frage der (literarischen) Übersetzung: Sehr viele Ihrer Texte wurden auch in Sprachen Ost-, Mittel- oder Südosteuropas übersetzt - haben Sie erlebt bzw. zumindest manchmal nachverfolgen können, wie Ihre Übersetzungen in der Region und in Übersetzung "leben"?
Umgekehrt aber würde mich noch interessieren: im Verhältnis zu der Vehemenz und Leidenschaft, mit der Sie sich in österreichische oder "westeuropäische" Fragen der Politik
und Kultur eingemischt haben, scheint Ihnen da jemals vorgekommen zu sein, dass Sie nicht mit derselben Intensität mit der Kultur des "südosteuropäischen" Ausland intergieren
wollten, konnten und mussten?
Darf ich zunächst mit der zweiten Frage beginnen. Ich lese manchmal bei uns im Standard oder in der FAZ oder sonstwo, daß z.B. Bernard Henry Levy, dieser französische Medienphilosoph, wieder seine meist recht einfältige Sicht der Dinge europaweit und also auch im deutschen Sprachraum verbreitet. Da gibt es eine begrenzte, aber eben doch vorhandene Zahl von Leuten, denen in Europa die Tore der Redaktionen offen stehen. Wenn z.B. Peter Nadas oder Peter Esterhazy etwas über Ungarn und Europa sagen wollen, hören die Leute ihnen auch in Franfurt oder Wien zu. Gleiches gelingt nur wenigen Intellektuellen des deutschen Sprachraums in umgekehrter Richtung. Ich werde immer mal wieder von einer polnischen Zeitung angerufen und in einem Telefoninterview zu irgendeinem Europa-Problem befragt, und selten meldet sich auch irgendwer von einer tschechischen oder kroatischen Zeitschrift, um einen Text von mir, den er entdeckt hat, für seine Zeitschrift zu acquirieren. Trotzdem habe ich es nie geschafft, in den "östlichen" Ländern z.B. eine regelmäßige Kolumne in einer kleinen feinen Zeitung zu ergattern, obwohl ich daran sehr interessiert gewesen wäre. Es scheitert aber am mangelnden Interesse Europas an Europa, wenn ich so sagen darf, also der Europäer an ihren eigenen Anliegen, und wohl auch an der Umständlichkeit, dass man solche Texte immer wieder erst übersetzen muss.
Ich darf da nicht nur lamentieren, muß mich auch an der eigenen Nase fassen. Als Herausgeber von Literatur und Kritik habe ich in den ersten Jahren regelmäßige Korrespondentebriefe aus Serbien, Slowenien, Ungarn, Rumänien erhalten, übersetzen lassen und gebracht. Das ist redaktionell natürlich aufwendiger, auch teurer, aber auch anspruchsvoller und sinnvoll. Es ist dann ein bißchen eingeschlafen, wohl auch durch meine Schuld. Manchmal denke ich, daß ich gerne eine Zeitung in deutscher Sprache lesen würde, die ausschließlich als internationales Blatt, als eine Art Presseschau firmieren und spannende Texte von Litauen bis Bulgarien finden und rasch präsentieren und so einer europäischen Öffentlichkeit, die ja fehlt, zur Verfügung stellen würde. An so einer Zeitung, wie es sie natürlich auch in den anderen europäischen Ländern eine geben sollte, würde ich gerne mitarbeiten. Was mir aber zu mühsam war und zu mühsam ist: Mich selbst auf die Suche begeben und befreundete Geister in Ljubljana anrufen, die dann erst nicht da sind und sich nach Tagen melden und die dann wieder herumtelefonieren müßten, ob ein bestimmter Redakteur wohl einen Text zu einer bestimmten Frage von mir bringen will... Dafür bin ich zu faul.

Und zur ersten Frage: Ich kann das ein bißchen mitverfolgen, aber nicht in jedem Falle. Viele Leute und, ich glaube, auch Sie, neigen dazu, meine europäische Wirksamkeit zu überschätzen. Es stimmt schon, einige Bücher von mir sind in einige Sprachen übersetzt worden, aber insgesamt ist es doch immer Stückwerk geblieben. Eine eigene Leserschaft konnte ich mir nur in Polen heranbilden, weil dort der rührigste Verlag existiert, den ich habe, der Czarne-Verlag, der jetzt mein sechstes Buch in Übersetzung herausgebracht hat. Wenn ich dort auf Lesereise bin, kommen manchmal schon ziemlich viele Leute zusammen, und es wird dann auch recht heftig und munter debattiert, und ich tauche auch gelegentlich in nationalen Debatten als Referenzgröße auf. Die österreichische Botschaft hat mir z.B. kürzlich einige Artikel zugeschickt, in denen sich nationalkonservative und liberale Polen anhand eines Kapitels in meinem Buch Im Wald der Metropolen hitzige Gefechte lieferten. Im entsprechenden Kapitel schreibe ich über die schlesische Minderheit, über ihre berechtigten Anliegen und die bornierten Anwandlungen mancher ihrer heutigen Proponnenten. In diesen Artikeln behaupten die einen, ich hätte als freier Europäer gezeigt, wie provinziell diese Minderheit sei, die anderen, dass ich ihr aus Kenntnis der europäischen Minderheiten ihren Status anerkenne. Also bin ich in einem typisch polnischen Diskurs drinnen, als Munition für zwei verfeindete Seiten. Das ist gar nicht schlecht, wenn auch ein großes Mißverständnis. Auch haben manche Gedanken, die ich über Europa z.B. im Europäischen Alphabet formuliert habe, in den polnischen Diskurs Eingang gefunden. In Slowenien, wo drei Bücher von mir übersetzt sind und ich den doch sehr renommierten Vilenica-Preis erhalten habe, gibt es auch Intellektuelle und Autoren, die mich schon rezipieren: aber wie nachhaltig das ist, um dieses Wort auch einmal loszuwerden, weiß ich nicht. Manchmal glaube ich, das war alles in Wahrheit gar nichts außer ein bißchen was für die Eitelkeit; dann hab ich wieder bessere Momente und denke mir, ja,. auf bescheidene Weise hast Du doch an diesem inoffiziellen, nicht institutionellen Gespräch freier Menschen über die Grenzen hinweg und hinaus teilnehmen können.
Oktober 2012

